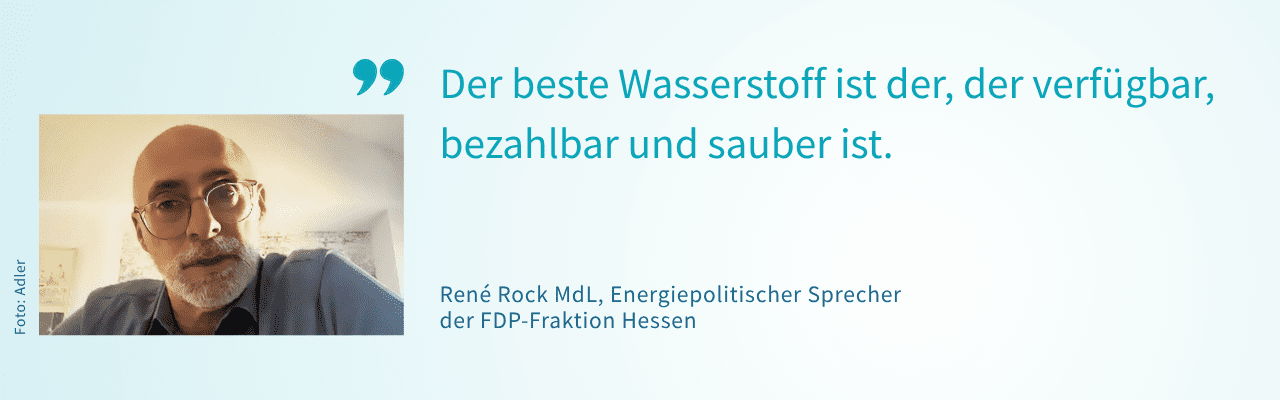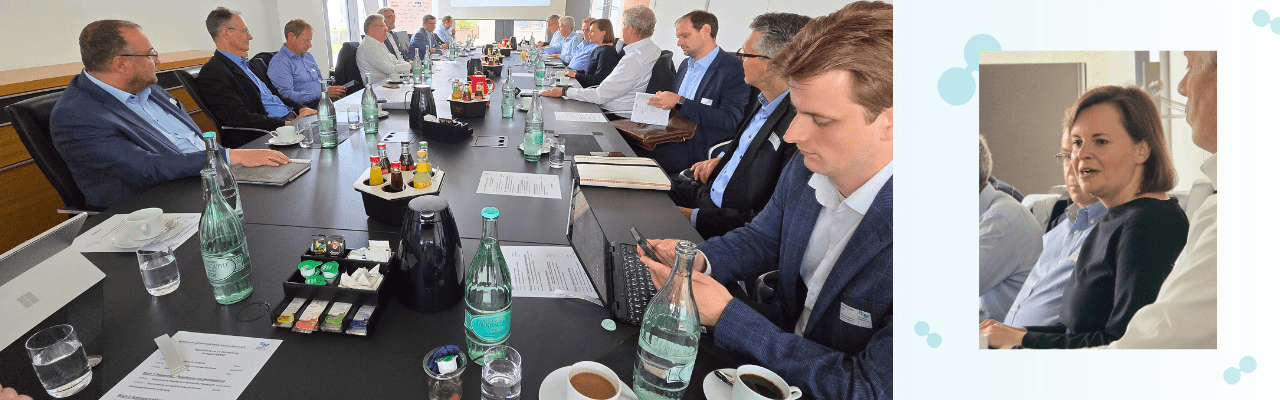René Rock, MdL und energiepolitischer Sprecher der FDP-Fraktion Hessen, war am 19. September 2025 als Gast zum digitalen Beiratstalk der H2BZ-Initiative Hessen geladen. In seinem Impulsvortrag ging er insbesondere auf die Chancen des kürzlich vereinbarten EU-USA-Energieabkommens ein. Er erläuterte seine Sicht auf die Potenziale, die die Zukunft der Wasserstoffwirtschaft in Hessen positiv beeinflussen könnten.
Am 27. Juli 2025 unterzeichneten EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und US-Präsident Donald Trump ein Energieabkommen, das die transatlantischen Beziehungen auf eine neue Stufe stellt. „Der Wasserstoffsektor wird in diesem Abkommen zwar nicht explizit erwähnt, jedoch eröffnen sich hierdurch neue Perspektiven für hessische Unternehmen, die von der Technologiekooperation und den Investitionen in den Wasserstoffmarkt profitieren können. Die Frage ist nicht, ob dieses Abkommen perfekt ist, sondern wie wir es für unsere Ziele nutzen können“, so Rock zum Einstieg. Dieses Abkommen könne Türen öffnen, die bisher verschlossen waren. Die enthaltenen Technologietransfer-Klauseln und das angekündigte Investitionsvolumen von 750 Milliarden US-Dollar bis 2028 werden einen riesigen Markt für deutsche und hessische Wasserstofftechnologien erschließen.
Hessen bietet ideale Voraussetzungen: Es verfügt über eine starke industrielle Basis, exzellente Forschungsinstitute wie das Fraunhofer IEE und die TU Darmstadt sowie eine hervorragende geografische Lage, die eine optimale Wasserstofflogistik ermöglicht. „Diese Potenziale müssen schnell und entschlossen genutzt werden. Die im Jahr 2021 vorgelegte hessische Wasserstoffstrategie war zwar ein erster Schritt, doch die Umsetzung erfolgt zu zögerlich“, erläutert Rock.
Die Zahlen sprechen für sich: Bis 2035 wird Deutschland jährlich etwa 7 Millionen Tonnen Wasserstoff benötigen. Heute werden davon gerade einmal Bruchteile grün produziert. „Ohne Brückentechnologien werden wir unsere Klimaziele verfehlen – nicht aus mangelndem Willen, sondern aufgrund physikalischer Limitierungen“, sagt Rock und setzt sich für Technologieoffenheit ein. Ein strategischer Vorteil, der sich aus dem Energieabkommen ergeben könnte, sind die technologischen Partnerschaften und Investitionen, die deutschen Unternehmen den Zugang zu den amerikanischen Märkten eröffnen werden.
Deutschlands Backbone für die Zukunft ist das H2-Kernnetz
Das im Oktober 2024 von der Bundesnetzagentur genehmigte deutsche Wasserstoff-Kernnetz ist ein entscheidender Schritt auf dem Weg zur Schaffung einer nationalen Wasserstoffinfrastruktur. Mit einer Länge von 9.040 Kilometern und Gesamtinvestitionen in Höhe von 18,9 Milliarden Euro soll das Netz bis 2032 ausgebaut werden. Es bildet das Rückgrat der deutschen Wasserstoffwirtschaft. „Hessen wird über Projekte wie H2ercules und Flow an das Kernnetz angeschlossen. Der Ausbau der regionalen Infrastruktur bleibt jedoch eine entscheidende Herausforderung, um den prognostizierten Wasserstoffbedarf auch in abgelegenen Regionen zu decken. Lassen Sie mich ehrlich sein: Hessen hinkt beim Wasserstoff hinterher“, sagt Rock und ergänzt: „Hessen verfügt über hervorragende Voraussetzungen für die Wasserstoffwirtschaft: Unsere industrielle Basis ist stark – von Infraserv Höchst als einem der größten Chemiestandorte Europas bis hin zu innovativen Mittelständlern, die in der Wasserstofftechnologie weltweit führend sind.“
Die Verknüpfung des deutschen H2-Kernnetzes mit einem bis 2040 28.000 Kilometer langen europäischen Netz kann Hessen daher zusätzlich als Knotenpunkt für den internationalen Wasserstoffhandel positionieren. Diese Entwicklungen bieten Hessen die Chance, als Modellregion für die intelligente Verknüpfung von regionaler und nationaler Infrastruktur voranzugehen.
„Unsere Forschungslandschaft ist exzellent: Das Fraunhofer IEE, die H2BZ-Initiative Hessen und die Technische Universität Darmstadt – wir haben das Know-how. Unsere logistische Lage ist unschlagbar: Frankfurt ist ein europäisches Drehkreuz, der Rhein eine wichtige Wasserstraße und wir haben dichte Verkehrsnetze – das sind ideale Voraussetzungen für die Wasserstofflogistik. Und nicht zuletzt kann unsere bestehende Gasinfrastruktur in Hessen zu einem Großteil für Wasserstoff umgerüstet werden. Das ist kostengünstiger als ein Neubau und nutzt vorhandene Trassen“, betont Rock.
Der historische Moment
Rock zieht ein handlungsorientiertes Fazit: „Wir leben in einer historischen Zeit. Das liegt nicht nur an den geopolitischen Umbrüchen und dem Klimawandel, sondern auch daran, dass sich die Grundlagen unserer Energieversorgung gerade fundamental wandeln. Das EU-USA-Energieabkommen ist ein Baustein in diesem Wandel. Ein Baustein, der zunächst fossil geprägt erscheint, aber die Türen für die Technologien der Zukunft öffnet. Wir haben die Wahl: Entweder wir gestalten diesen Wandel aktiv mit und positionieren Hessen als Vorreiter im Bereich Wasserstoff, oder wir schauen dabei zu, wie andere die Zukunftsmärkte erobern.“